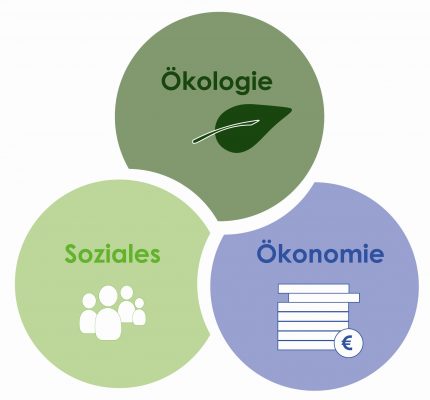„Das verstehe ich unter Nachhaltigkeit“, sagt meine Sitznachbarin in einer großen Tischrunde, in der wir uns gerade über Holzbau unterhalten. Sie wohnt und arbeitet in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert. Jetzt rechnet sie uns vor, wie viel Kohlenstoff in den alten und neu ergänzten Holzbalken gespeichert ist und welchen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz das Wohnen im Bestand leistet. Die meisten nicken zustimmend. Nur eine in der Runde ist anderer Ansicht. Sie sagt, sie verstehe Nachhaltigkeit ganz anders. „Nachhaltig ist das, was mir guttut. Ich reise gerne, gehe gerne gut essen.“
Bei C.A.R.M.E.N. e.V. sprechen wir viel über Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe und Energieeffizienz und verwenden den Begriff Nachhaltigkeit. Doch welche Idee steckt hinter dem Begriff? Lässt sich diese Idee überhaupt fassen, wenn gefühlt jeder etwas anderes darunter versteht? Versuchen wir es.
Von der Waldbewirtschaftung zum globalen Zukunftsvertrag
Für Hans Carl von Carlowitz, der 1713 den Begriff verwendete und auf den sich die Forstwirtschaft gerne als „Vater der Nachhaltigkeit“ bezieht, war eine nachhaltige Waldbewirtschaftung die Voraussetzung dafür, dass stets genug Bau-, Werk- und Brennholz für den Bergbau und für die Metallverhüttung und somit für das Fortkommen des Landes zur Verfügung steht. Nicht vom Kapital wollte er leben, sondern von den Zinsen. Raubbau am Wald galt es zu verhindern. Allerdings empfahl er auch den Ersatz von Holzbrennstoffen durch Torf. Denn damit, so seine Idee, ließe sich viel Nutzungsdruck vom Wald nehmen. Was aus Klimaschutzgründen heute völlig abwegig erscheint, nämlich die Ausweitung der Torfverbrennung, war damals, beim seinerzeitigen Kenntnisstand, ein durchaus ernst zu nehmender Gedanke und konnte als Option für den dauerhaften Erhalt der Wälder präsentiert werden.
Dem modernen Verständnis von Nachhaltigkeit ist die Idee der schonenden Ressourcennutzung geblieben, nun allerdings im offenen Prozess der nachhaltigen Entwicklung. Längst geht es nicht mehr um den Wald allein. Die Umwelt-, Entwicklungs- und Sicherheitsdebatte der vergangenen Jahrzehnte hat den Begriff überformt. Globale Zusammenhänge rückten in den Blick, Armutsbekämpfung und Chancengleichheit traten in den Fokus internationaler Nachhaltigkeitsbemühungen. Gegenwärtig stehen wir mit der Agenda 2030 in einem globalen Zukunftsvertrag, welcher Umwelt- und Sozialpolitik miteinander verbindet und unser nachhaltiges Handeln an 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung misst. Angesichts dieses großformatigen Rahmens liegt die Frage nahe, wo wir einzelne uns hier verorten können.
Das Leitbild mit Inhalten füllen
Vielleicht finden wir die Antwort in einem Lehrbuch. Dort heißt es etwas kompliziert, Nachhaltigkeit sei ein Leitbild, welches den Erhalt der natürlichen Umwelt und die Realisierung von Gerechtigkeit sowohl innerhalb als auch zwischen den Generationen zum Ziel hat. Es geht also, wie schon bei Carlowitz, um Zukunftsverantwortung; im Mittelpunkt steht der Mensch. Das Leitbild fordert uns zum Handeln auf, wir sollen eine zukunftsfähige Welt gestalten, welche sowohl die gegenwärtigen Bedürfnisse befriedigt als auch den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt und ein positives soziales Miteinander hinterlässt und den Menschen die Möglichkeit gibt, ihr Leben in gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen einzurichten. Wie wir das machen, das bleibt uns überlassen – unserer Fähigkeit, sich einzumischen, zu kommunizieren, zu kooperieren. Das Leitbild gibt lediglich die grobe Richtung vor.
Damit sind wir beim Kern des Nachhaltigkeitsbegriffs angelangt: Es gibt sie nicht, die eine Nachhaltigkeit. Wir alle sind angehalten, das Leitbild laufend mit Inhalten zu füllen und diese Inhalte auf Wirkungen und mögliche Irrwege abzuklopfen. Vieles davon wird vorläufig sein, auch Korrekturen können nötig werden – so wie die Torf-Idee des Carlowitz längst verworfen ist. Bei der demokratischen Auseinandersetzung um mögliche Pfade nachhaltiger Entwicklung können uns Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung unterstützen, auch seitens der Politik erwarten wir Impulse. Leitplanken, vielleicht auch Managementansätze können hilfreich sein, um den offenen Prozess als Konzept oder Strategie unter einem Dach zusammenzudenken. Den großen Zielrahmen und die dazu passenden Prüfsteine auf unserem tastenden Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit bieten die Ziele der Agenda 2030.
Klimaschutz und Transformation
Zugegeben: Unklarheit und Wandelfähigkeit sind immer eine Herausforderung. Die Idee der Nachhaltigkeit hat sich laufend verändert, und sie wird sich auch weiterhin verändern. So trägt der Begriff der nachhaltigen Transformation dem Bedürfnis nach mehr Klimaschutz Rechnung und fokussiert auf die Schaffung einer klimaverträglichen Gesellschaft. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Offenheit entfaltet das Handlungsprinzip nachhaltiger Entwicklung in unseren Lebenswelten seine Wirkung. Denken wir nur an die vielen kommunalen Maßnahmen und Projekte zu Schwerpunktthemen, an zivilgesellschaftliche Initiativen oder an den Vorbildcharakter unternehmerischer Nachhaltigkeit. Damit die Akteure zu Verständigung gelangen und unterschiedliche Interessen ausbalancieren können, braucht es allerdings eine problem- und kontextbezogen Herangehensweise, meist also ein Handeln in kleinen Schritten. Sonderlich kompliziert ist das keinesfalls. Sondierung, Schwerpunktsetzung, Priorisierung und kooperatives Handeln in Sachen Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der beschriebenen Tischrunde.
Grenzwertig wird es allerdings, wenn wir das Leitbild vom Erhalt der natürlichen Umwelt und der Generationengerechtigkeit aus dem Blick verlieren und nur noch den eigenen Vorteil als nachhaltig sehen wollen. Schlimmer noch: wenn das eigene Handeln gerechtfertigt werden soll, indem es als umweltfreundlich und nachhaltig präsentiert wird, ohne dass substanziell ein nachhaltiges Handeln stattfindet. Auch dafür gibt es einen Begriff: Greenwashing.

Gilbert Krapf, Abteilungsleiter Nachhaltigkeit
Weitere Informationen und einen Überblick zu aktuellen Publikationen und Veranstaltungsterminen gibt es unter www.carmen-ev.de/nachhaltigkeit/