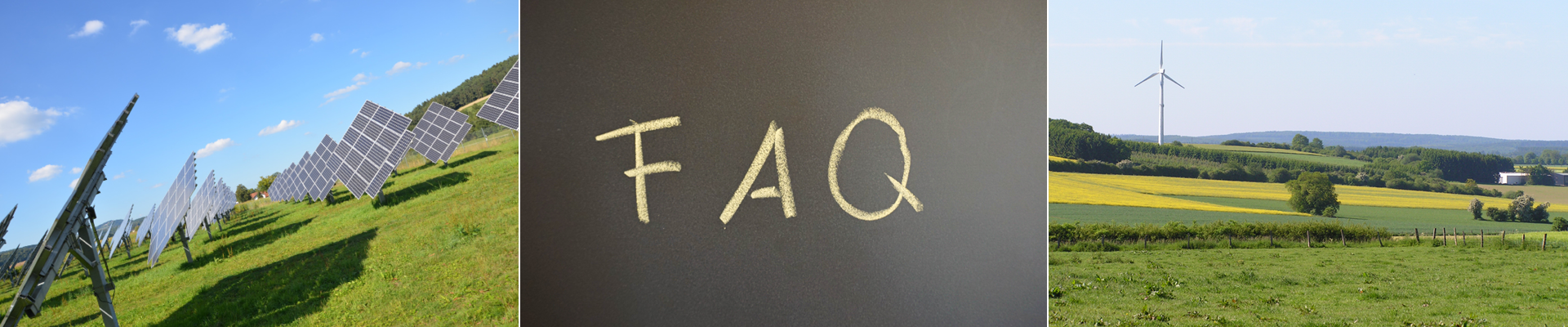Batteriespeicher
Wo gibt es aktuelle Informationen zu den technischen Daten von Batteriespeichern?
Informationen zu Batteriespeichern finden Sie etwa in der von C.A.R.M.E.N. e.V. erstellten „Marktübersicht Batteriespeicher“. Diese lässt sich hier kostenfrei abrufen. Die Marktübersicht wird jährlich aktualisiert und gibt eine Orientierungshilfe über derzeit am Markt verfügbaren Speichersysteme.
Wie sollte ein Batteriespeicher im Heimbereich dimensioniert werden?
Mit der Dimensionierung ist vor allem die Bestimmung des nutzbaren Speichervermögens gemeint. Dieses wird als Nutz- oder Nettokapazität bezeichnet. Bei einer gewerblichen Nutzung ist zusätzlich die Entladeleistung von Bedeutung. Für eine erste eigenverbrauchsoptimierte Auslegung kann folgende Faustformel angewendet werden: Pro 1.000 kWh Jahresstromverbrauch sollte der Batteriespeicher etwa 1-2 kWh Nutzkapazität aufweisen, wenn jeweils mindestens 1 kWp PV-Leistung installiert ist. Je nach Ausrichtung der Photovoltaikanlage, des Stromverbrauchs über den Tag hinweg oder der Art der Stromverbraucher, wie Wärmepumpe oder E-Auto, kann sich das Verhältnis ändern.
Wie hoch ist die Lebensdauer eines Batteriespeichers?
Die Lebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab, etwa von der Speichertechnologie, der Anzahl an Ladezyklen, der Art und Weise des Batterie- und Lademanagements oder auch von der Umgebungstemperatur. Bei Lithium-Ionen-Speichern geben Hersteller oft eine Lebensdauer von 6.000 und mehr Lade- und Entladezyklen an. Ein durchschnittlicher Haushalt kann rein rechnerisch den Speicher etwa 200 – 250 Mal pro Jahr komplett be- und entladen. Daraus würde sich häufig eine theoretische Lebensdauer von über 25 Jahren ergeben.
Zusätzlich zur zyklischen Alterung unterliegen Batteriespeicher aufgrund von chemischen Vorgängen in den Batteriezellen einer sogenannten „kalendarischen Alterung“ wodurch die Kapazität der Batterie stetig sinkt. Bei Lithium-Ionen-Speichern für Heimanwendungen kann deshalb lediglich von einer Lebensdauer zwischen 15 und 20 Jahren ausgegangen werden.
Zusätzlich zur zyklischen Alterung unterliegen Batteriespeicher aufgrund von chemischen Vorgängen in den Batteriezellen einer sogenannten „kalendarischen Alterung“ wodurch die Kapazität der Batterie stetig sinkt. Bei Lithium-Ionen-Speichern für Heimanwendungen kann deshalb lediglich von einer Lebensdauer zwischen 15 und 20 Jahren ausgegangen werden.
Wo muss ein Batteriespeicher registriert werden?
Ein Batteriespeicher muss als eigene Einheit, also zusätzlich zur PV-Anlage, im Marktstammdatenregister registriert werden. Dies sollte innerhalb 4 Wochen nach der Inbetriebnahme geschehen. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit sind hier zu finden.
Was kostet ein Batteriespeicher?
Die Kosten für den Speicher variieren stark je nach Ausstattung und Größe. Bezogen auf eine nutzbare Speicherkapazität von 1 kWh ergeben sich für Heimspeicher häufig Kosten in der Größenordnung zwischen 400 und 600 €. Für einen Speicher mit 10 kWh Nutzkapazität wäre demnach mit rund 4.000 € bis 6.000 € zu rechnen. Bei größeren Speichersystemen liegen die Kosten pro kWh niedriger.
Kann ein Heimspeicher wirtschaftlich betrieben werden?
Die Kombination von Photovoltaikanlagen mit einem Batteriespeicher ist im Kontext privater Anlagen heute übliche Praxis. Aufgrund der stark gesunkenen Preise für Stromspeicher kann ein solcher die Stromkosten merklich verringern und so die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage steigern. Wichtig ist in diesem Kontext, dass das Speichersystem mit Hinblick auf den Stromverbrauch und die PV-Leistung dimensioniert wurde. Ein zu großer Speicher kann nur unzureichend mit PV-Strom beladen werden, sodass dessen Auslastung im Jahresverlauf gering ist. Ist der Speicher zu klein, können die Potenziale zur Eigenverbrauchsoptimierung nicht voll ausgeschöpft werden während die spezifischen Investitionskosten pro kWh Kapazität hoch sind.
Auch für bereits bestehende PV-Anlagen kann die Nachrüstung eines Heimspeichers eine Option sein. Je niedriger die EEG-Vergütung für Strom der PV-Anlage und je höher die Strombezugskosten, desto besser ist hier die Wirtschaftlichkeit.
Auch für bereits bestehende PV-Anlagen kann die Nachrüstung eines Heimspeichers eine Option sein. Je niedriger die EEG-Vergütung für Strom der PV-Anlage und je höher die Strombezugskosten, desto besser ist hier die Wirtschaftlichkeit.
Wird das Haus über den Batteriespeicher mit Strom versorgt, im Falle eines Stromausfalls?
Nicht unbedingt. Dazu muss ein Speicher mindestens notstromfähig sein. Manche Hersteller bieten diese Option an. Eventuell fallen hier Zusatzkosten an. Man unterscheidet typischerweise drei Arten der Notstromversorgung:
• Notstromfähigkeit: Es ist beispielsweise eine einzelne Steckdose am Gerät vorhanden, die bei einem Stromausfall genutzt werden kann. Die zur Verfügung stehende Leistung ist hierbei begrenzt. Die PV-Anlage produziert keinen Strom mehr, es kann nur der restlich Energieinhalt des Speichers genutzt werden.
• Back-Up-Fähigkeit: Der Speicher kann die Stromversorgung im Gebäude aufrechterhalten, jedoch nicht unterbrechungsfrei (z. B. nur durch Betätigung eines Schalters). Die zur Verfügung stehende Leistung ist häufig begrenzt. Erst durch diese Back-Up-Fähigkeit kann auch wieder der PV-Wechselrichter versorgt werden, die PV-Anlage somit Strom produzieren und ebenso zur Stromversorgung beitragen oder den Speicher beladen.
• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): Das Prinzip der USV ist typischerweise, dass die Sicherstellung der elektrischen Versorgung des Gebäudes in vollem Umfang ohne merkbare Unterbrechung erfolgt. Die PV-Anlage kann auch hier Strom erzeugen.
• Notstromfähigkeit: Es ist beispielsweise eine einzelne Steckdose am Gerät vorhanden, die bei einem Stromausfall genutzt werden kann. Die zur Verfügung stehende Leistung ist hierbei begrenzt. Die PV-Anlage produziert keinen Strom mehr, es kann nur der restlich Energieinhalt des Speichers genutzt werden.
• Back-Up-Fähigkeit: Der Speicher kann die Stromversorgung im Gebäude aufrechterhalten, jedoch nicht unterbrechungsfrei (z. B. nur durch Betätigung eines Schalters). Die zur Verfügung stehende Leistung ist häufig begrenzt. Erst durch diese Back-Up-Fähigkeit kann auch wieder der PV-Wechselrichter versorgt werden, die PV-Anlage somit Strom produzieren und ebenso zur Stromversorgung beitragen oder den Speicher beladen.
• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): Das Prinzip der USV ist typischerweise, dass die Sicherstellung der elektrischen Versorgung des Gebäudes in vollem Umfang ohne merkbare Unterbrechung erfolgt. Die PV-Anlage kann auch hier Strom erzeugen.
Mit welchem Eigenverbrauch kann gerechnet werden, wenn zur PV-Anlage noch ein Speicher installiert wird?
In Privathaushalten kann der Eigenverbrauch durch den Einsatz eines auf Eigenverbrauch optimierten Batteriespeichers um durchschnittlich 25-30 Prozentpunkte erhöht werden. Eine Modellberechnung (Anteil des Eigenverbrauchs und Autarkiegrades), die den Jahresstromverbrauch sowie die installierte Leistung der PV-Anlage und die Nutzkapazität des Speichers berücksichtigt, ist etwa auf der Seite der htw Berlin zu finden.
Gibt es Förderungen für Batteriespeicher?
Derzeit besteht in Deutschland oder Bayern kein landesweites Förderprogramm, das die Investition in einen Batteriespeicher durch einen Direktzuschuss unterstützt. Möglicherweise bieten einzelne Kommunen einen Investitionszuschuss im Rahmen lokaler Förderprogramme an.
Das “Bundesprogramm Energieeffizienz” für landwirtschaftliche Betriebe ist mit Stand August 2025 pausiert, sodass derzeit keine Antragstellung möglich ist.
Generell ist es möglich, für die Errichtung von PV-Anlagen und Batteriespeichern das Förderprogramm „Erneuerbare Energien – Standard“ (Programm 270) der KfW-Bank in Anspruch zu nehmen.
Über dieses Programm erhält man ein Darlehen, allerdings ohne Tilgungszuschuss. Die Anträge für die KfW-Programme sind bei der örtlichen Hausbank zu stellen. Hier sind weitere Informationen zu diesem Förderprogramm zu finden.
Das “Bundesprogramm Energieeffizienz” für landwirtschaftliche Betriebe ist mit Stand August 2025 pausiert, sodass derzeit keine Antragstellung möglich ist.
Generell ist es möglich, für die Errichtung von PV-Anlagen und Batteriespeichern das Förderprogramm „Erneuerbare Energien – Standard“ (Programm 270) der KfW-Bank in Anspruch zu nehmen.
Über dieses Programm erhält man ein Darlehen, allerdings ohne Tilgungszuschuss. Die Anträge für die KfW-Programme sind bei der örtlichen Hausbank zu stellen. Hier sind weitere Informationen zu diesem Förderprogramm zu finden.
Geht von einem Heimspeicher eine erhöhte Brandgefahr aus?
Generell weisen elektronische Geräte immer ein gewisses Brandrisiko auf. Bei sorgfältiger und fachgerechter Installation und Beachtung regulatorischer Vorschriften wie VDE AR-E-2510-50 oder VDE AR-E-2510-2 ist dieses aber sehr gering.
Nichtsdestotrotz ist zum Schutz von Rettungskräften eine Kennzeichnung am Hauptzugang bzw. am Sicherungskasten, die auf eine PV-Anlage und einem Batteriespeicher hinweist, sinnvoll.
Nichtsdestotrotz ist zum Schutz von Rettungskräften eine Kennzeichnung am Hauptzugang bzw. am Sicherungskasten, die auf eine PV-Anlage und einem Batteriespeicher hinweist, sinnvoll.
Wo sollte ein Heimspeicher aufgestellt werden?
Der Ort der Installation ist abhängig von den jeweiligen Batteriesystemen bzw. -technologien und sollte den aufgeführten Bedingungen in der Montageanleitung entsprechen. Dies ist wichtig, um einen sicheren Betrieb und eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten. Ein weiterer Punkt ist, darüber mögliche Garantieansprüche geltend machen zu können. Der Standort sollte trocken, sauber und staubfrei sein sowie fernab möglicher Brandquellen. Eine ganzjährig moderate Umgebungstemperatur zwischen 5 und 25 °C ist typischerweise zu empfehlen. Eine räumliche Nähe zum PV-Wechselrichter und Sicherungskasten ist hilfreich, um Leitungslängen kurz zu halten.