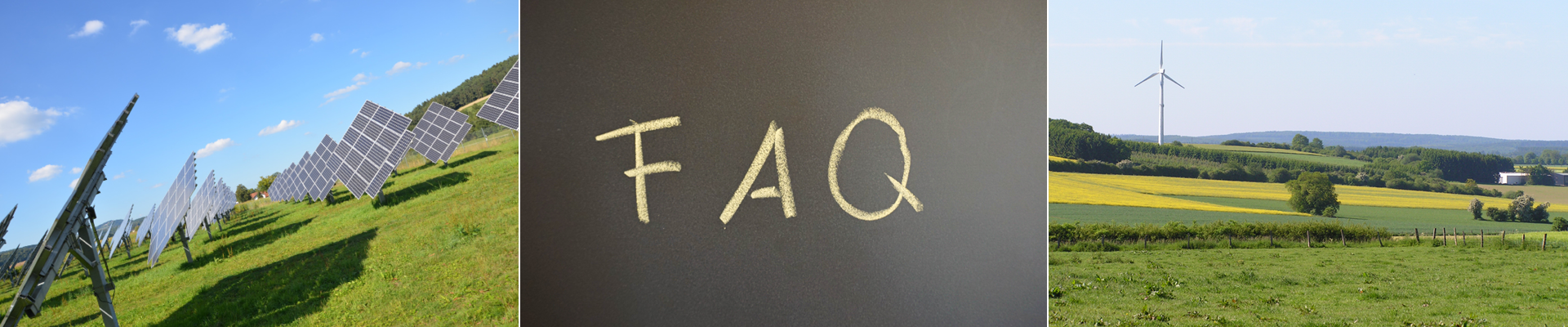Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
Die Funktionsweise einer Wärmepumpe ist im Prinzip identisch mit der eines Kühlschrank, nur das Haupteinsatzgebiet ist ein anderes (Heizen statt Kühlen). Bei einem Kühlschrank wird den Lebensmitteln Wärme entzogen, die an die Umgebungsluft abgeführt wird. Bei der Wärmepumpe dagegen wird der Umgebung (Wasser, Luft, Boden) Wärme auf niedrigem Temperaturniveau entzogen, die mithilfe eines Kältemittels bei einer höheren Temperatur an das Heizsystem abgegeben wird.
Kann eine Wärmepumpe auch kühlen?
Grundsätzlich ist es mit einer Wärmepumpe auch möglich Gebäude zu kühlen. Dabei wird zwischen zwei Arten der Kühlung unterschieden. Bei einer aktiven Kühlung wird der Heizkreis der Wärmepumpe „einfach“ umgedreht. Das Gebäude ist dann sozusagen die Wärmequelle und z. B. der Erdboden oder das Grundwasser der „Wärmeabnehmer“. Die Raumtemperatur kann so drei oder mehr Grad gesenkt werden. Bei der passiven Kühlung wird der Kältekreislauf der Wärmepumpe ausgeschalten. Es wird dann die eigentliche Temperatur des Erdreichs oder Grundwassers also z.B. ca. 10 °C übertragen.
Kann eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden?
Die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik ist möglich und in vielen Fällen vorteilhaft für die Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Mit einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach können je nach Größe und Ausrichtung zwischen 30% und 50% des Strombedarfs der Wärmepumpe gedeckt werden.
Was ist der Unterschied zwischen der Leistungszahl, dem COP und der Jahresarbeitszahl?
Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch verschiedene Kennzahlen ausgedrückt. Der COP (Coefficient of Performance) beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom unter genormten Testbedingungen.
Der SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) bezieht sich auf einen gesamten Heizzeitraum und berücksichtigt somit reale Witterungsbedingungen. Ein SCOP von 4 bedeutet z. B., dass aus einer kWh Strom im Jahresdurchschnitt vier kWh Wärme erzeugt werden.
Für eine praxisnähere Bewertung wird häufig die JAZ (Jahresarbeitszahl) verwendet. Sie zeigt die tatsächliche Effizienz einer konkreten Anlage im realen Betrieb – also unter Berücksichtigung der individuellen Gebäudeeigenschaften und Nutzungsgewohnheiten. Je nach Wärmequelle können hier verschiedene Werte erreicht werden. Je niedriger die Vorlauftemperatur und je besser das Gebäude gedämmt ist, desto höher fällt die Effizienz aus.
Welches Heizverteilsystem kann ich mit Wärmepumpen betreiben?
Grundsätzlich gilt je niedriger die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Heizungsvorlauf, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind deshalb Fußbodenheizungen oder andere Flächenheizsysteme (z.B. Wandheizungen), die mit Vorlauftemperaturen von max. 30 ° bis 35 °C auskommen. Es können jedoch auch Heizkörper, die für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sind, mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Nicht geeignet sind hingegen Systeme, die eine Vorlauftemperatur von über 55 °C erfordern.
Split-Klimageräte (auch Luft-Luft-Wärmepumpen) benötigen weder Flächenheizung noch Heizkörper. Hier wird die Wärme (oder Kälte) direkt an die Raumluft abgegeben. Das Brauchwasser muss in diesem Fall durch einen separaten Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermie, Brauchwasserwärmepumpe oder Durchlauferhitzer) erhitzt werden.
Welche Wärmequellen stehen zur Verfügung?
Wärmepumpen können je nach Bauart verschiedenste Wärmequellen nutzen. Die am weitesten verbreitete Wärmepumpenart ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sie ist nahezu überall einsetzbar und nutzt ganzjährig die Umgebungsluft als Wärmequelle. Auch Luft-Luft-Wärmepumpen, sogenannte „Klimasplitgeräte“, nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle. Diese übertragen die erzeugte Wärme im Gegensatz zu Luft-Wasser-Wärmepumpen aber nicht an ein wassergeführtes Verteilsystem (Fußbodenheizung oder Heizkörper), sondern direkt an die Raumluft.
Daneben gibt es mit Erdsonden, Erdkollektoren und Grundwasserbrunnen verschiedene Möglichkeiten, Erdwärme als Wärmequelle für Sole-Wasser-Wärmepumpen zu nutzen. Erdwärmesysteme profitieren von den ganzjährig konstant hohen Temperaturen der Wärmequelle und sind deshalb besonders effizient.
Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz einer Wärmepumpe zur Gebäudebeheizung bieten Kalte Nahwärmenetze. Hierbei wird eine Wärmequelle für mehrere Gebäude gemeinsam erschlossen (z. B. ein Erdsondenfeld, die Abwärme eines Unternehmens, ein Abwasserkanal oder ein Fluss) und dieses ca. 5–20 °C warme Wasser über ein Leitungsnetz an die einzelnen Häuser verteilt. Dort nutzen kleine Sole-Wasser-Wärmepumpen das lauwarme Wasser als Wärmequelle für die Gebäudebeheizung.
Wie laut ist eine Wärmepumpe?
Beim Betrieb einer Wärmepumpe entstehen Geräusche, etwa durch das Rotieren der Ventilatoren und den Kompressor. Bei modernen Wärmepumpengeräten kann diese Geräuschentwicklung durch technologische Fortschritte und verbesserte Konstruktion auf maximal 45 dB(A) reduziert werden, was der Lautstärke eines Gesprächs gleichkommt. Viele Geräte nutzen mittlerweile außerdem einen Nachtbetrieb, bei dem der Schallleistungspegel auf 35 dB(A) sinkt.
Gibt es Unterschiede bei den Kältemitteln?
In der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel, welches die Wärme aus der Umwelt aufnimmt und diese nach einem Verdichtungsschritt an das Verteilsystem im Gebäude abgibt. Bis vor einigen Jahren wurden als Kältemittel aufgrund ihrer vorteilhaften thermodynamischen Eigenschaften überwiegend Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) wie R32 und R410A eingesetzt. Moderne Wärmepumpen nutzen vermehrt natürliche Kältemittel wie Propan (R290) oder CO2 (R744), da diese im Fall einer Leckage deutlich weniger zur globalen Erwärmung beitragen. Beim Einbau einer Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel erhält man deshalb im Zuge der BEG-Förderung einen Bonus von 5 %.
Wo ist der optimale Platz für das Außengerät?
Der optimale Aufstellungsort hängt von verschiedensten Faktoren sowie der individuellen Situation vor Ort ab. Ein möglichst kurzer Leitungsverlauf zum Innengerät minimiert i. d. R. die Wärmeverluste und Installationskosten. Gleichzeitig sollten Optik und Geräuschentwicklung berücksichtigt werden, insbesondere in der Nähe von Nachbargebäuden. Die Wahl eines witterungsgeschützten Ortes kann z. T. die Vereisung des Verdampfers vorbeugen.
Ist mein Haus geeignet für eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpenanlage läuft umso effizienter, je niedriger die Vorlauftemperatur im Heizverteilsystem ist. Die Vorlauftemperatur bezeichnet die Temperatur des Wassers, das vom Heizsystem an die Heizkörper oder die Fußbodenheizung abgegeben wird. In Bestandsgebäuden liegt die maximal benötigte Vorlauftemperatur häufig bei 60 °C oder mehr. Für den effizienten Einsatz einer Wärmepumpe sollte die maximale Vorlauftemperatur jedoch auf unter 55 °C abgesenkt werden können, um einen effizienten Betrieb mit geringen Betriebskosten zu ermöglichen.
Wie kann ich die Vorlauftemperatur absenken?
Zunächst können Sie prüfen, ob die Vorlauftemperatur in Ihrem Heizkreislauf abgesenkt werden kann. Dies kann entweder selbst über das Menü Ihrer Heizungssteuerung oder mit Hilfe eines Fachmanns erfolgen. Für eine Testphase mit schrittweiser Reduzierung der Vorlauftemperatur eignen sich die kälteren Wintermonate.
Nach der Senkung der Temperatur sollte das Ergebnis beobachtet werden. Es gilt zu prüfen, ob die Räume weiterhin komfortabel beheizt werden und ob der Warmwasserbedarf ausreichend gedeckt wird. Falls es zu kalt wird oder die Heizleistung nicht ausreicht, kann die Temperatur wieder leicht angehoben werden.
Die Vorlauftemperatur lässt sich nicht auf unter 55 Grad Celsius absenken. Was kann ich tun?
Lässt sich die maximal benötigte Vorlauftemperatur in Ihrem Gebäude nicht auf unter 55 °C absenken, gibt es verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. Eine Maßnahme ist der Austausch von Heizkörpern durch großflächigere Heizkörper oder spezielle Niedrigtemperaturheizkörper. Auch einzelne Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle, wie ein Fenstertausch oder das Dämmen des Daches bzw. der obersten Geschossdecke, ermöglichen, dass die maximale Vorlauftemperatur im Heizkreislauf abgesenkt werden kann.
Was ist eine Brauchwasserwärmepumpe?
Eine Brauchwasserwärmepumpe funktioniert wie eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe, wird jedoch lediglich zur Erhitzung von Brauchwasser für Dusche, Badewanne und Waschbecken genutzt. Die Investitionskosten sind dementsprechend gering. Aufgestellt wird sie häufig im Keller oder auf dem Dachboden. Dort nutzt sie die Umgebungsluft als Wärmequelle zur Brauchwassererhitzung. Ihr Einsatz ist vor allem dann vorteilhaft, wenn das Heizsystem auf Gas oder Holz basiert. Denn im Sommer, wenn das Gebäude nicht geheizt werden muss, können Holz- oder Gasheizung ruhen, während die Brauchwasserwärmepumpe zur Erzeugung von Trinkwarmwasser von den hohen Temperaturen der Umgebungsluft profitiert.
Wann lohnt sich ein Wärmepumpenstromtarif?
Wärmepumpenstromtarife, auch Heizstromtarife genannt, werden von Energieversorgern für den Betrieb von Wärmepumpen angeboten und liegen in der Regel einige Cent pro kWh unter dem Haushaltsstromtarif. Gerade bei hohen Stromverbräuchen der Wärmepumpe empfiehlt sich deshalb häufig die Nutzung eines solchen Tarifs. Hierfür benötigen Sie einen separaten Stromzähler, der den Wärmepumpenstromverbrauch misst. Übersteigt die jährliche Ersparnis durch den niedrigeren Strompreis für die Wärmepumpe die Installationskosten für den zusätzlichen Stromzähler und dessen Gebühr, lohnt sich der Wärmepumpenstromtarif.
Kann man auch ein Mehrfamilienhaus mit einer Wärmepumpe beheizen?
Wärmepumpen gibt es in allen Leistungsgrößen. Für Mehrfamilienhäuser werden i. d. R. Wärmepumpenanlagen zwischen 20 kW – 100 kW eingesetzt. Hierzu werden häufig sogenannte Wärmepumpenkaskaden genutzt, bei denen mehrere Wärmepumpengeräte miteinander verschaltet werden. Somit kann die Heizleistung für Heizung und Warmwasser flexibel an den aktuellen Heizbedarf des Gebäudes angepasst werden. Anstatt ein Mehrfamilienhaus mit einer zentralen Wärmepumpenanlage zu beheizen, gibt es auch die Möglichkeit je Etage eine kleinere Wärmepumpe zu installieren, ähnlich wie bei herkömmlichen Gas-Etagenheizungen.
Funktioniert eine Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen im Winter?
Ja, Wärmepumpen sind so ausgelegt, dass sie auch bei Außentemperaturen von -10 °C zuverlässig arbeiten. Besonders effizient sind dabei Erd- und Grundwasser-Wärmepumpen, da deren Wärmequellentemperatur ganzjährig weitestgehend konstant bleibt. Auch Luft-Wasser-Wärmepumpen sind für den Betrieb im Winter geeignet – gegebenenfalls unterstützt durch einen integrierten Elektroheizstab, der nur bei sehr kalten Bedingungen, z.B. unter -5 °C, einspringt. Entscheidend für den effizienten Betrieb ist die richtige Auslegung der Anlage und ein möglichst niedriges Temperaturniveau im Heizsystem.
Wie lange hält eine Wärmepumpe?
Die Lebensdauer nach VDI-Richtlinie 2067 liegt bei 18 Jahren. Mit regelmäßiger Wartung und fachgerechter Installation kann eine Wärmepumpe jedoch auch länger zuverlässig arbeiten. Die Lebensdauer hängt unter anderem von der Qualität der verbauten Komponenten und den Betriebsbedingungen ab. Während Verdichter oder Ventilatoren nach vielen Jahren ausgetauscht werden müssen, bleibt das Gesamtsystem mit bspw. Fundament, Bohrungen sowie Speicher- und Verteilsystem über Jahrzehnte funktionstüchtig. Erdsonden, Flächenkollektoren oder Grundwasserbohrungen können weit über 50 Jahre genutzt werden.
Wie effizient ist eine Wärmepumpe?
Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch verschiedene Kennzahlen ausgedrückt. Der COP (Coefficient of Performance) beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom unter genormten Testbedingungen.
Der SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) bezieht sich auf einen gesamten Heizzeitraum und berücksichtigt somit reale Witterungsbedingungen. Ein SCOP von 4 bedeutet z. B., dass aus einer kWh Strom im Jahresdurchschnitt vier kWh Wärme erzeugt werden.
Für eine praxisnähere Bewertung wird häufig die JAZ (Jahresarbeitszahl) verwendet. Sie zeigt die tatsächliche Effizienz einer konkreten Anlage im realen Betrieb – also unter Berücksichtigung der individuellen Gebäudeeigenschaften und Nutzungsgewohnheiten. Je nach Wärmequelle können hier verschiedene Werte erreicht werden. Je niedriger die Vorlauftemperatur und je besser das Gebäude gedämmt ist, desto höher fällt die Effizienz aus.